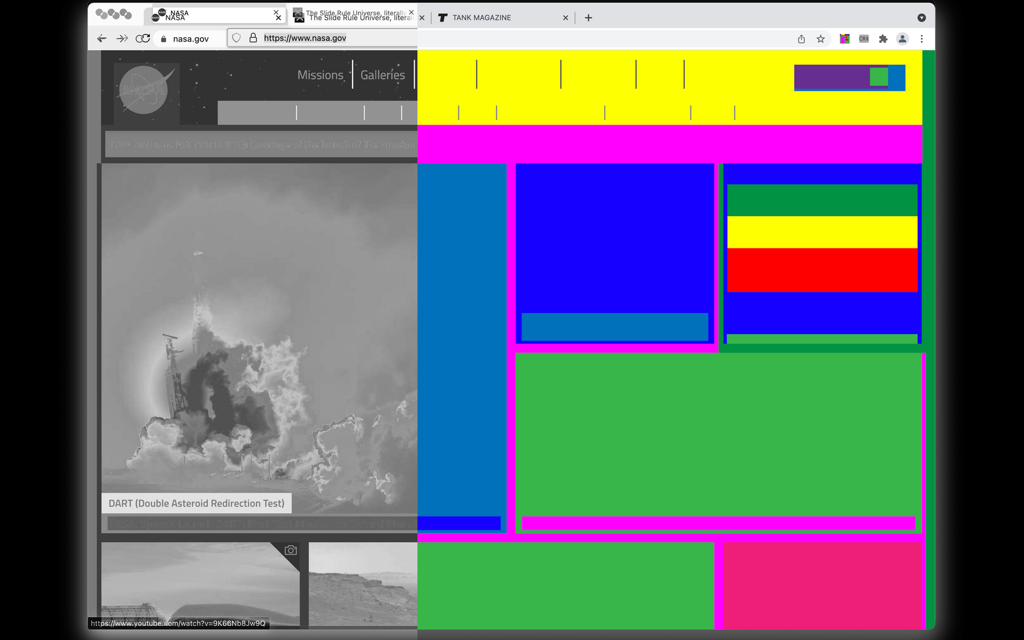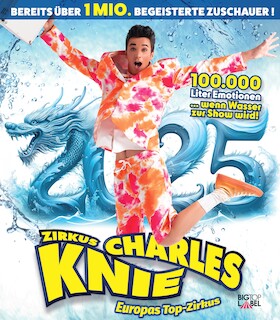Hallo, ich bin Maya.
Hallo, ich bin Maya.Wie kann ich helfen?
Mit der Ausstellung »The Story That Never Ends. Die Sammlung des ZKM« gibt das ZKM | Karlsruhe einen umfassenden Einblick in die eigene Sammlung, die mit ca. 12.000 Werken zu den größten und bedeutendsten Medienkunstsammlungen der Welt gehört. Die Ausstellung erzählt nicht nur von den miteinander verwobenen Geschichten von Kunst und Technologie, sondern auch von den Herausforderungen, die die schnelllebigen technologischen Medien für Museen weltweit mit sich bringen.
Die Geschichte der Medienkunst von den 1950er-Jahren bis heute
Elektrifizierung und Digitalisierung haben die Welt verändert. Dieser Wandel erfasste nicht nur unseren Alltag, sondern wirkte sich auch auf das künstlerische Schaffen aus.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts nutzen Künstler:innen diese sich rasant weiterentwickelnden Technologien und erweitern so kontinuierlich die Ausdrucksmöglichkeiten der Kunst: Das Spektrum reicht von Video-, Licht- und Klangkunstwerken, über motorbetriebene kinetische Objekte, bis hin zu computerbasierten interaktiven Installationen oder Werken, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erzeugt wurden.
Mit etwa 100 Arbeiten zeichnet »The Story That Never Ends« diese Entwicklungslinien der apparativen Künste und ihre Öffnung zu den Kategorien Raum, Zeit und Bewegung sowie Interaktion und Partizipation nach – von den 1950er-Jahren bis in die Gegenwart. Eine Auswahl bedeutender Schlüsselwerke, die wichtige Momente und Meilensteine der Medienkunst repräsentieren, stellen die Vielfalt und den Einfluss dieser technologischen Entwicklungen dar. Marie-Jo Lafontaines monumentale Videoskulptur »Les larmes d’acier« (1987), mit der sie auf ironische Weise die komplexen Begriffskonstellationen „Mann, Maschine, Macht und Sexualität“ paradigmatisch dekonstruiert sowie Bill Violas Video-Klanginstallation »Stations« (1994), die zentrale Aspekte seines künstlerischen Schaffens wie grundlegende Themen menschlichen Daseins vereint oder Jeffrey Shaws »Virtual Sculpture« (1981), die für frühe Experimente der Augmented Reality steht, bilden hier eine kleine Auswahl an Beispielen.
Gleichzeitig macht die Ausstellung auch den sozial- und gesellschaftspolitischen Rahmen, in dem die Werke entstanden sind nachvollziehbar, um Rückschlüsse und Bezüge zu den drängenden Fragen unserer heutigen Zeit zu ermöglichen: Feministische Arbeiten früher (Medienkunst-)Pionierinnen, wie beispielsweise pezoldo (aka Friederike Pezold), Lynn Hershman Leeson, Kirsten Geisler oder Rebecca Horn, sind hier genauso zu nennen wie Arbeiten, die die Auswirkungen der Massenmedien wie Fernsehen (Nam June Paik, Wolf Vostell), die Verbindung zwischen Technologie und Militär, Grenzen und Überwachung oder Gewalt im digitalen Raum (Paul Garrin, Hanna Haaslahti, David Rokeby) oder natürliche Ökosysteme (Justine Emard, Claudia González Godoy) reflektieren. Immer wieder hinterfragen Künstler:innen die Möglichkeiten und Auswirkungen neuer Medien, denken und gestalten sie um, und bringen so neue soziale und kulturelle Narrative hervor, die den Diskurs über unser Verhältnis zu Technologie prägen.
Wir betrachten Kunst, wie der Ausstellungstitel suggeriert, als eine Geschichte, die niemals enden wird, solange es Menschen gibt. Dass wir nicht wissen, welche Form sie in der Zukunft annehmen wird, hat sie mit der Technologie gemeinsam. Unser Wissen über die Vergangenheit und Gegenwart beeinflusst, wie wir die Zukunft gestalten und das, was noch kommen wird, wertschätzen.
Die Medienkunstrestaurierung
„Die Geschichte, die niemals endet“ spielt nicht nur auf die künstlerische Entwicklung, sondern auch auf die Herausforderungen an, mit denen Museen konfrontiert sind, die Medienkunstwerke sammeln: Technische Geräte sind nicht für die Ewigkeit gemacht, Datenträger zerfallen, Softwarestandards sind rasch überholt und Medienformate sind nach wenigen Jahren nicht mehr lesbar. Das bedeutet, dass Werke kontinuierlich von Restaurator:innen überwacht und technisch aktualisiert werden müssen. Welche Auswirkungen hat dies auf die Kunst und unser kulturelles Gedächtnis? Welche Fähigkeiten müssen wir entwickeln, um nicht nur eine Zukunft zu haben, sondern auch eine Vergangenheit?
Das ZKM verfügt über eine international anerkannte Expertise in der Konservierung und Restaurierung von Medienkunst. Da diese konservatorischen und restauratorischen Arbeiten jedoch vornehmlich im Verborgenen geschehen, geht »The Story That Never Ends« einen radikalen Schritt: Die Entscheidung, welche Schlüsselwerke aus der Sammlung in der Ausstellung gezeigt werden, wurde den Restaurator:innen des ZKM anvertraut. Sie bringen so verborgene Schätze ans Licht, die aufgrund von aufwändigen Erhaltungsmaßnahmen zum Teil seit Jahrzehnten nicht mehr öffentlich sichtbar waren. Da die Werke selbst nicht unbedingt die Komplexität ihrer Technik und die Herausforderungen ihrer Erhaltung offenbaren, bietet die Ausstellung zusätzlich eine Einführung in die Technikgeschichte und in die Konservierungsstrategien für diese Art von Werken.
Der Blick von der Vergangenheit in die Zukunft
»The Story That Never Ends« erzählt somit anhand der einzigartigen Sammlung des ZKM nicht nur die faszinierende Geschichte der Medienkunst. Sie macht auch die Fragilität unserer elektrifizierten und digitalisierten Zivilisation deutlich. Die Ausstellung ermöglicht einen tiefgehenden Einblick in die Kunst- und Technikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts und zeigt, wie Geschichte den Blick auf die Gegenwart schärft und anregt, mögliche Zukünfte zu imaginieren.
Mi bis Fr: 10 bis 18 Uhr Sa, So: 11 bis 18 Uhr